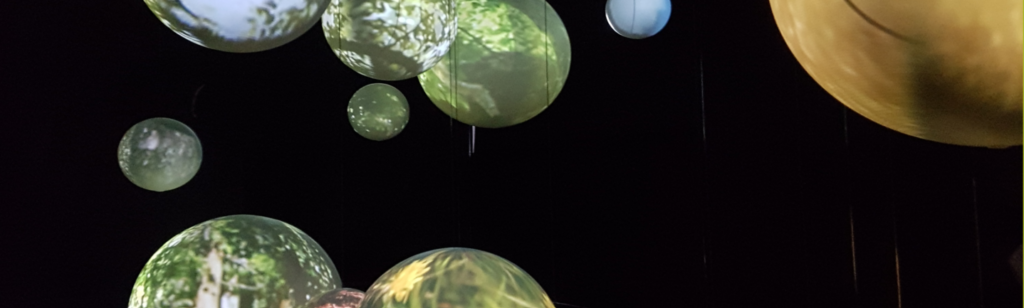Am 27. & 28. März 2025 versammelten sich an der Universität Augsburg zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich aus unterschiedlichen Disziplinen heraus mit wissenssoziologischer Diskursforschung und daran anschlussfähigen Perspektiven und Programmen beschäftigen. Das Tagungsprogramm sah dabei einen Wechsel zwischen Keynotes und parallel stattfindenden Streams vor, in welchen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wurden.
Neben neueren theoretischen Entwicklungen war dabei vor allem das weitreichende Spektrum an Sachverhalten und Themen interessant, die mit dem Methodenkanon der Diskursforschung bearbeitet werden können. Um hier nur einige zu nennen:
Leonie Reuter der Freien Universität Berlin gab beispielsweise Einblicke in eine historisch-soziologische Diskurs- und Dispositivanalyse in Bezug auf wasserbezogene Problematisierungen im Berlin des 19. Jahrhunderts, Rosa Johanna Gruner der Hochschule Darmstadt versteht Gleichstellungmaßnahmen für MINT-Studentinnen als Interventionsdispositiv, Dr. Gabriel Malli der FH Joanneum Graz befasst sich mit der Modifikation journalistischer Diskurspraktiken und damit analysiert damit einhergehende Subjektivierungsformen im Social Web und Fabian Lechner der katholischen Privatiuniversität in Graz nutzt die von der Wissenssoziologischen Diskursanalyse bereitgestellten Werkzeuge zur Rekonsturktion des Profils kirchlicher Sozialträger.
Auch Daniel präsentierte am Freitagnachmittag im Panel zur Diskurs- und Dispositivanalyse von Umweltproblemen seine Forschung. Hier hielt Daniel einen Vortrag zur diskursiven Konstruktion biologischer Vielfalt im Bereich der Agrar- und Landwirtschaft in Deutschland. Die von Daniel identifizierte Grundannahme lautet, dass Praktiken der intensiven Landwirtschaft, wie der Einsatz von Pestiziden, der Anbau von Monokulturen, oder die vollständige Nutzung der Ackerfläche durch die aufkommende Forderung nach Schutz und Erhalt von Arten bedründungsbedürftig werden. Mit Blick auf die mediale Berichterstattung zeichnen sich hier diskursive Muster ab, die insofern auf ein Machtungleichgewicht hindeuten, als dass vor allem Wissenschaftler:innen über die Macht verfügen, ihre Interessen zu artikulieren, wohingegen Landwirt:innen selbst deutlich weniger zur Sprache kommen. Hierbei werden Praktiken der intensiven Landwirtschaft, Subventionen und Förderungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union sowie Praktiken der sozial-ökologischen Landwirtschaft von den an der Debatte beteiligten Akteuren unterschiedlich legtimiert, verfolgen prinzipiell aber ein und dieselbe Logik: Grundsätzlich geht es darum, ökonomisch effizient zu wirtschaften, dass heißt, mit möglichst geringen Kosten einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Eben diesen Logik greifen Wissenschaftler:innen auf, um Praktiken der sozial-ökologischen Landwirtschaft, wie den Einsatz innovativer Techniken, den Anbau von Mischkulturen oder das Ansetzen von Blühstreifen nachhvollziehbar zu begründen mit dem Ziel, dass Spannungefeld zwischen intensiver Landwirtschaft und Artenschutz zu lösen.
Insgesamt verdeutlicht die Teilnahme an der Tagung den breiten Anwendungsbereich wissenssoziologischer Diskursforschung auf ganz unterschiedliche Themenfelder, deren Notwendigkeit nicht zuletzt in der Wirksamkeit ungleich machtvoller diskursiver Konstruktionen von Wirklichkeit liegt.
Nach vielen Gesprächen und intensivem Austausch in den Panels fand die Tagung ihren Abschluss in einer Tagungsparty im Shostage in Augsburg, bei welcher sich auch Professor:innen am DJ-Pult ausprobierten.
Vielen Dank an die Organisator:innen der Tagung, allen voran an Martin Blessinger, Claudia Foltyn, Prof. Dr. Reiner Keller und Amira Malik!